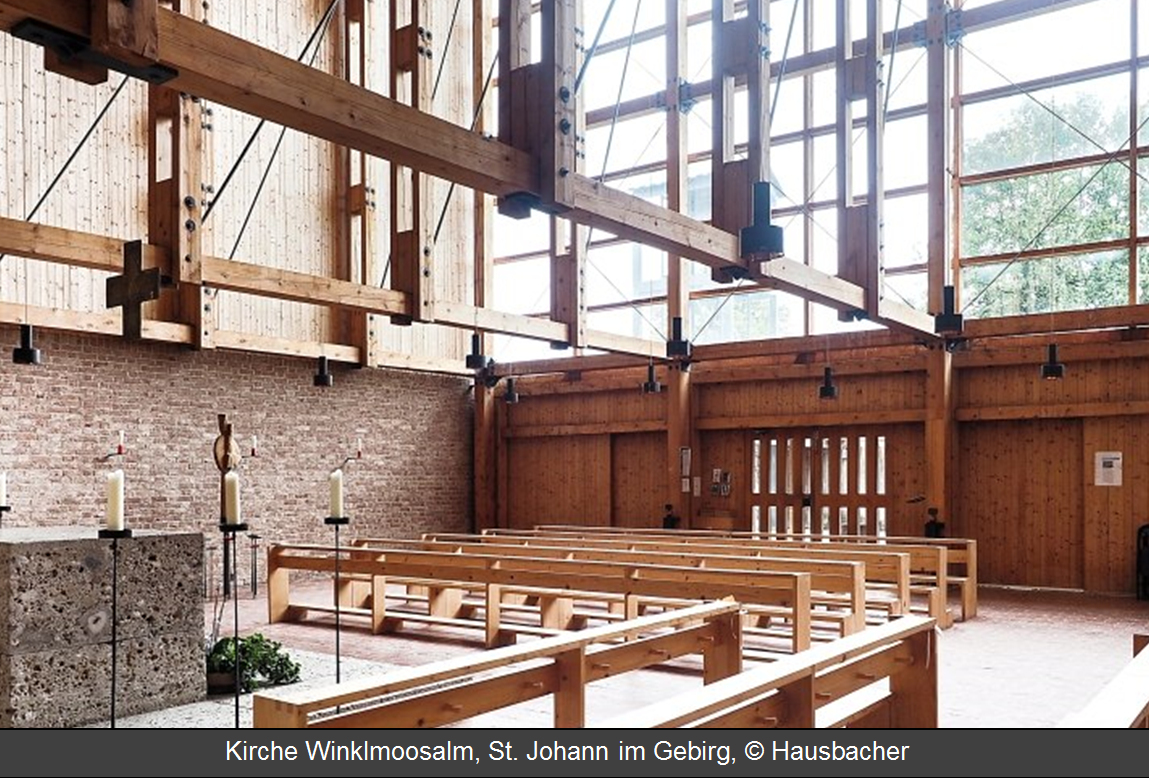Folge #13 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren
Wie Adaptive Optik der Atmosphäre ein Schnippchen schlägt
In diesem Video-Podcast wird geklärt, was Adaptive Optik bei Teleskopen ist, wie adaptive Optik funktioniert und welche Vorteile diese Technik den Astronomen bietet. Die Adaptive Optik hilft Atmosphären-Störungen zu beseitigen.
Wie Adaptive Optik der Atmosphäre ein Schnippchen schlägt
Ein Bäcker aus Deutschland, ein Bürofachangestellter aus Österreich, ein Löwendompteur aus Frankreich und ein Berufsastronom von einem Observatoriums aus Chile stehen unterm Nachthimmel und schauen hoch zu den flimmernden, flackernden und funkelnden Sternen. Wie erkennt man den Berufsastronomen aus diesem Grüppchen?
Vor gut 20 Jahren hätte man ihn problemlos ausfindig machen können. Denn der Berufsastronom hätte die Augen verdreht und dazu lauthals herumgejammert. Sternengefunkel ist nämlich für Berufsastronomen schlimmer als ne Flaute für Segler oder große Hitze für Schneemänner. Denn das Wabern der Luft, das die kleinen Lichtpünktchen am Nachthimmel so herrlich tanzen und jedem Romantiker das Herz hüpfen lässt, ist wie ein rotes Tuch für Berufsastronomen. Denn egal wo sie sich auf dieser Welt auch hinverdrücken: die Turbulenzen der Atmosphäre sind überall vorhanden. Selbst auf den entlegenen Bergen in Chile oder Südafrika, wo riesige Observatorien weitab menschlicher Zivilisation stehen, wabert die Luft in der Atmosphäre immer noch ein kleines bisschen. Und somit bekommen die Astronomen in ihren Teleskopen nicht das, was sie eigentlich unbedingt gerne hätten: 100% knackscharfe Bilder mit hoher Detailtiefe und hohem Kontrast. Rein rechnerisch schaffen alle großen Hochleistungs-Teleskope dieses Ziel. Doch die wabernde Atmosphäre verhindert das und verweist die Teleskope auf ihre Plätze. Unter etwa 0,4-0,5 Bogensekunden an Auflösungsvermögen schafft kein Groß-Teleskop – egal wo es auf der Welt steht.
Was man gegen das Wabern und die Bildverzerrungen tun kann? … Ganz einfach: die Teleskope über die störende Erdatmosphäre bringen. Was heißt: Die Dinger ins Weltall schießen. Denn dort oben wabert nix mehr und man bekommt quasi die perfekte Welle, … also die perfekte Lichtwelle … und somit das perfekte Bild. Und genau das machen wir Menschen auch: wir schießen Teleskope ins All. Das Hubble-Teleskop ist beispielsweise ein solches Weltraum-Teleskop. Über dieses Thema habe ich übrigens bereits in Folge 9 von Abenteuer Sterne ausführlich erzählt.
Doch jetzt kommt’s … Das Blatt hat sich mittlerweile zugunsten der erdgebundenen Teleskope gewendet. Denn wir Menschen bauen mithilfe ausgefuchster Technik mittlerweile so gute Teleskope, dass damit das Wabern in der Erdatmosphäre so gut wie komplett ausgeknipst werden kann – und zwar auf Knopfdruck. Da Ergebnis ist derart gut, dass man an das theoretische, also rechnerisch ermittelte Auflösungsvermögen herankommt. Und das führt dazu, dass die erdgebundenen Teleskope, die mit dieser Technik ausgestattet sind, das Auflösungsvermögen von Weltraum-Teleskopen mittlerweile sogar übertreffen. Unglaublich!
Diese ausgefuchste Technik, die es so aussehen lässt, als wäre gar keine Erdatmosphäre vorhanden, bezeichnet man als Adaptive Optik. Doch wie genau funktioniert diese Adaptive Optik?
Dazu müssen wir uns zunächst das Licht genauer anschauen, das uns die Himmelskörper auf die Erde senden. Bis es auf unsere Erdatmosphäre trifft, ist es glatt. Genauer gesagt sind die Wellenfronten des Lichtes glatt bzw. besser ausgedrückt: sie sind eben. Eine solche Wellenfront ist im physikalischen Sinne eine Fläche, auf der alle Punkte denselben Abstand zur Quelle haben. In unserem Fall ist der Stern die Quelle. Er strahlt das Licht auf seiner kugeligen Oberfläche in alle Richtungen ab und somit ergeben sich unmittelbar um den Stern herum auch kugelförmige Wellenfronten. Weil die Sterne aber so extrem weit von uns entfernt sind, kommen die Wellenfronten nicht mehr kugelförmig, sondern glatt und eben an. So weit, so gut. Gestört werden diese ebenen Wellenfronten erst, wenn sie in die Erdatmosphäre eintauchen. Dann nämlich werden die einzelnen Lichtteilchen, zu denen man auch Photonen sagt, an den verschieden warmen, feuchten und dichten Luftzellen jeweils unterschiedlich stark gebrochen und ändern damit jeweils geringfügig ihre bisherige Richtung. Die bei uns ankommende Wellenfront ist somit nicht mehr eben, sondern sieht verbogen aus. Quasi wie durch die Mangel genommen. Salopp kann man auch sagen, dass Licht beim Durchgang durch die Atmosphäre etwas verknittert wird. Diese Verknitterung macht nur ein paar wenige Millimeter aus. Und genau diese Störung der Wellenfront, bzw. präziser ausgedrückt diese Phasenstörungen des Lichtes bügelt die Adaptive Optik aus.
Ganz einfach gesagt kann man sich die Funktionsweise einer Adaptiven Optik so vorstellen, dass sich das Teleskop einfach in Gegenrichtung zum tanzenden Sternenlicht bewegt und somit die Verknitterung des einfallenden Lichtes komplett kompensiert. Diese Gegenbewegung wird realisiert durch einen kleinen Hilfsspiegel im Teleskop. Dieser kann so angesteuert werden, dass er genau die entgegengesetzte Form der einfallenden Wellenfront annimmt. Das reflektierte Licht ist somit wieder eben und glatt, bzw. komplett ungestört.
Bevor wir die Funktion der Adaptiven Optik genau unter die Lupe nehmen, müssen wir uns noch den grundsätzlichen Strahlenverlauf in einem Spiegelteleskop ansehen. Zunächst trifft das verknitterte Sternenlicht in Form von parallelen Lichtstrahlen auf den leicht gewölbten Hauptspiegel am Teleskop-Boden. Von dort aus wird das Licht zurück Richtung Himmel reflektiert und trifft auf den sogenannten Sekundärspiegel. Weil der Haupt-Spiegel aber eine leichte Krümmung hat, laufen die zurückreflektierten Strahlen nicht mehr parallel zum Sekundärspiegel weiter, sondern sind gebündelt und vereinen sich in der sogenannten Brennebene des Hauptspiegels. In der Brennebene befindet sich das scharfe Abbild des Himmelskörpers. Weil sich dieses Abbild im Teleskop befindet, hat der Sekundärspiegel die Aufgabe, es aus dem Teleskop heraus zu einem Detektor zu reflektieren. Der Detektor kann das Auge sein, ein Fotoapparat oder sonst ein Aufzeichnungsgerät.
Eine Adaptive Optik wird aus diesem Teleskop, wenn man nun diesen kleinen verformbaren Hilfsspiegel in den Strahlengang bringt. Bezogen auf den Lichtverlauf zwischen Sekundärspiegel und Detektor. Und zwar in der Nähe der Brennebene. Dieser Hilfsspiegel nimmt nun das vom Sekundärspiegel abgestrahlte verknitterte Licht auf. Dann sagt ein Signal eines Computers, ob und wie genau der Spiegel sich verformen muss, um das Licht bestmöglich zu entknittern. Und dann wird das entknitterte Licht weiter in Richtung Detektor reflektiert, damit man sich das Bild des Himmelskörpers betrachten kann. So weit, so gut. Woher weiß nun aber der Computer, welche Signale er dem verformbaren Spiegel senden muss, damit das Licht durch Spiegelverformung bestmöglich entknittert wird? Er weiß es, weil ein Teil des Lichtes kurz vor dem Detektor mit einem Strahteiler abgegriffen wird und in einen sogenannten Wellenfront-Sensor gelenkt wird. Dieses Gerät misst im Prinzip die Stärke und Charakteristik der Licht-Verknitterung und leitet das Ergebnis an den Computer weiter. Und der sagt dann dem verformbaren Spiegel, wie genau er sich verformen muss. Und dann geht es wieder von vorne los: Aus dem abgegriffenen Lichtanteil werden über den Sensor wieder die Störungen in der Atmosphäre ermittelt und daraus berechnet der Computer in Echtzeit die passende Spiegelverformung. Dieser Regelkreis läuft etwa 100 Mal pro Sekunde ab. Denn nur so schafft man es, die sich rasch ändernden Turbulenzen der Atmosphäre zu kompensieren. Das ist Adaptive Optik. Durch Spiegelverformung atmosphärische Störungen in Echtzeit kompensieren. Zwar ein extrem aufwendiger, hochkomplexer Hightech-Vorgang, aber mit genialen Resultaten.
Diese Spiegelverformung wird allerdings nicht mechanisch durchgeführt. Das wer viel zu langsam und ungenau. Stattdessen wird das mithilfe von speziellen Kristallen realisiert, deren Ausdehnung man durch das Anlegen unterschiedlich hoher elektrischer Spannungen variieren kann. Eine sehr pfiffige Sache. Ganz anders bei der Aktiven Optik, die ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Hier werden zwar Bildverzerrungen, die durch die Wirkung der Schwerkraft auf den Spiegel entstehen und auch aufgrund von Temperaturschwankungen, ebenso durch gezielte Spiegelverformungen kompensiert. Und auch hier wird der Zustand des Spiegels im Rahmen eines Regelkreises mit einem Wellenfront-Sensor überwacht und ein Computer berechnet daraus die nötige Spiegelverformung. Doch reicht es bei dieser Aktiven Optik, dass der Regelkreis 1 Mal pro Sekunde durchläuft und die Spiegelverformung funktioniert bei dieser Aktiven Optik mechanisch, und nicht mithilfe von unter Spannung gesetzten Kristallen, wie bei der Adaptiven Optik. Das sind die beiden Unterschiede zwischen der Aktiven und der Adaptiven Optik. Weil sich aber beide Korrekturverfahren exzellent ergänzen, sind moderne Großteleskope mittlerweile mit beiden Systemen ausgestattet, was natürlich zu noch viel besseren Ergebnissen füht.
Doch zurück zur Adaptiven Optik bzw. speziell zur Licht-Verknitterung durch die Atmosphäre. Die macht sich nämlich dann ganz besonders stark bemerkbar, wenn man eine sehr helle, punktförmige Lichtquelle detektiert. Und darum wird bei der Adaptiven Optik einfach ein heller Stern genutzt, um die atmosphärischen Störungen bestmöglich zu erfassen. Da die Astronomen zumeist lichtschwache Objekte beobachten, brauchen sie folglich zusätzlich einen hellen Stern. Und das zwingend im selben Blickfeld. Denn es nutzt ja nichts, mithilfe eines hellen Stern über dem Westhorizont die dortige Atmosphären-Turbulenz zu ermitteln, wenn man gerade ein Himmelsobjekt betrachtet, das genau über einem steht. Und genau das ist der Haken: Nicht neben jedem Himmelsobjekt, das man beobachten will, steht zufällig ein geeigneter heller Stern. Doch weil die Astronomen schlaue Füchse sind, erzeugen sie sich diesen Referenz-Stern einfach künstlich. Das geschieht heutzutage mit einem speziellen Natrium-Laser, der gelbes Licht erzeugt. Hier macht man sich zu Nutze, dass es in der Hochatmosphäre in etwa 90 Kilometer Höhe ein relativ großes Reservoir an natürlich vorkommendem Natrium gibt. Das hält sich selbst recht gut im Gleichgewicht. Zwar verschwinden dort oben durch Witterungseinflüsse ständig Natriumatome. Gleichzeitig werden aber durch Staub von verglühten Meteoren, also Sternschnuppen, ständig neue Natriumatome in das Reservoir eingetragen. Regt man nun diese Natrium-Atome in 90 Kilometer Höhe mit diesem speziellen Natrium-Laser an, kommt es wegen der Elektronen in den Natrium-Atomen zu einer sogenannten Resonanz-Fluoreszenz. Und damit ist dort oben ein heller, gelbleuchtender Stern zu sehen, den Astronomen auch als Leit-Stern bezeichnen. Eine solche Anregung von Natriumatomen geschieht übrigens auch bei den gelbleuchtenden Natriumdampflampen, die man an vielen Straßenkreuzungen stehen sieht. Hier werden die Natriumatome nur nicht so intensiv angeregt.
Der Vorteil eines so hellen Leitsterns in so großer Höhe ist auch, dass die Astronomen einen entsprechend lange Luftsäule entlang der Sichtlinie auf Störungen hin analysieren können, was dem Endergebnis natürlich in hohem Maß zu Gute kommt. Und mittlerweile wird an manchen Observatorien nicht nur ein Leitstern erzeugt, sondern zeitgleich 4, die um das zu beobachtende Objekt angeordnet sind. Damit kann man noch viel besser erfassen, wie sich die Atmosphäre unmittelbar um das Objekt der Begierde herum verhält und somit noch effektiver den Spiegel der Adaptiven Optik verformen, um die atmosphärischen Störungen zu kompensieren. So geschehen im Frühjahr 2016 beim einem der vier 8,2 Meter Teleskope des Very Large Telescope der ESO am Cerro Panal in Chile.
Doch solche speziellen hochmodernen Natrium-Laser, wie sie heute bei vielen Großteleskopen dieser Welt eingesetzt werden, wachsen natürlich nicht auf Bäumen. Die Astronomen profitierten sowohl beim Thema Adaptive Optik, als auch beim Einsatz künstlicher Leitsterne von umfangreicher Vorarbeit und Forschungen des Militärs, die Anfang der 1990er Jahre freigegeben wurden. Aufbauend darauf haben die Astronomen das Ganze dann auf die Astronomie umgemünzt und alles in jahrelanger Forschungsarbeit ausgebaut und verfeinert. Gerade bei der Laser-Technologie forschte die Europäische Südsternwarte seit Anfang dieses Jahrtausends intensiv und konnte so mit der Unterstützung von deutschen und kanadischen Firmen erstmals gleich mehrere Quantentechnologien in die Astronomie einführen. Und so lässt sich die heutige Generation dieser Laser vergleichsweise einfach und nahezu wartungsfrei und dabei aber hocheffektiv und effizient betreiben.
Alles in allem verstehen Sie jetzt sicher recht gut, warum der zu Beginn der Folge genannte Berufs-Astronom unter dem funkelnden Sternenhimmel so ruhig geblieben ist. Kein Gejammere. Kein Gefluche. Einfach nur genießen. Denn er weiß, dass er ins einem Teleskop ein großkalibrige Waffe gegen das Stern-Gefunkle hat …